|
|
|
Bei allen unten aufgeführten Schadstoffen finden Sie jeweils Informationen zu den Themen
¨ Gesundheitsgefährdung
¨ Krankheitsbilder
¨ Vorkommen des jeweiligen Schadstoffs
|
|
|
|
|
|
|
Asbest
|
|
Was ist Asbest?
|

Asbest ist die Gruppenbezeichnung für natürlich vorkommende, verfilzte Mineralfasern. Asbest ist chemisch sehr stabil (griech.: asbestos = unauslöschbar), brennt nicht, hat eine hohe elektrische und thermische Isolierfähigkeit, weist hohe Elastizität und Zugfestigkeit auf und lässt sich gut in Bindemittel einbinden.
|
|
Verwendung
|
Wegen seiner vielseitigen Eigenschaften wurde Asbest eingesetzt z. B. für Hitzeschutzkleidung, Brandschutzplatten, Spritzmassen, Anstriche, Fußbodenbeläge, Dichtungen, Bremsbeläge, Kupplungsbeläge, Asbestzementprodukte (Platten, Rohre, Wellplatten, Pflanzgefäße, Lüftungsleitungen), Klebstoffe, Dichtungsmassen und Kitte
|
|
Gesundheits-
gefährdung
|
Gesundheitsschädigend wirkt Asbest in erster Linie durch Einatmen der Asbestfasern. Die kritische Größe dieser Fasern ist ausschlaggebend für die eindeutig krebserzeugende Wirkung von Asbest.
|
|
|
Durch Asbest ausgelöste Krankheitsbilder:
|
|
|
v Staublunge durch Asbeststaub (Asbestose)
v Unheilbarer und innerhalb kurzer Zeit zum Tode führender Tumor
des Brust- und Bauchfells (Mesotheliom)
v Lungenkrebs (Bronchialkarzinom)
|
|
Schadstoffe in dieser Gruppe
|
v Aktinolith-Asbest
v Amosit-Asbest
v Anthophyllit-Asbest
v Chrysotil-Asbest
v Krokydolith-Asbest
v Tremolit-Asbest
|
|
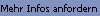
|
|
Zurück
|
|
|
|
|
PAK (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe)
|
|
Was ist PAK?
|
PAK ist die Abkürzung für polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (englisch: PAH = polycyclic aromatic hydrocarbons) und bezeichnet eine Stoffgruppe mit mehreren hundert Einzelverbindungen. Ihr chemisches Merkmal sind mindestens drei direkt aneinander gebundene Benzolringe. PAK entstehen bei der Erhitzung bzw. Verbrennung von organischen Materialien unter Sauerstoffmangel (unvollständige Verbrennung).
|
|
Vorkommen
|
In Erdöl sind PAK von Natur aus enthalten. Sie kommen aber auch in Gemüse, geräucherten, gegrillten und gebratenen Fleischprodukten und Tabakrauch vor.
In Gebäuden sind PAK hauptsächlich zu finden in:
v teer- und pechhaltigen Klebstoffen
v Farben unter Holzparkett und Hirnholzfußboden
v teerhaltige Beschichtung (innen) von Trinkwasserleitungen
v Bitumenerzeugnissen (zum Teil asbesthaltig)
v Asphalt-Fußbodenbelägen (Gussasphalt, Hochdruckplatten)
v Bitumierten Dichtungs- und Dachbahnen
v Bitumenlösungen, Bitumenvergussmassen /-lacken, /-emulsionen
|
|
Verwendung
|
Verwendung finden PAK vor allem in Bitumen- und Steinkohlenteer-Produkten sowie zur Herstellung anderer Chemikalien.
|
|
Gesundheits-
gefährdung
|
Zahlreiche PAK sind nachweislich krebserzeugend, insbesondere solche aus vier und mehr Benzolringen (Ausnahme: Phenanthren). Außerdem wirken viele PAK giftig auf das Immunsystem und die Leber, schädigen das Erbgut und reizen die Schleimhäute. Genauere Angaben sind nur zu jedem Vertreter im Einzelnen möglich.
|
|
Schadstoffe in dieser Gruppe
|
v Anthracen
v Benzo[a]pyren
|
|
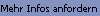
|
Zurück
|
|
|
|
|
PCB
|
|
Was ist PCB?
|
PCB ist ein Gemisch aus 209 verschiedenen chemischen Verbindungen
Eigenschaften:
v nahezu unbrennbar und feuerhemmend
v erweicht Kunststoffe
v schwer biologisch abbaubar
v besitzt geringe akute Toxizität
Einsatzgebiet:
v Isoliermittel in Transformatoren und Kondesatoren
v Weichmacher in Bewegungsfugen und Fugendichtmassen
v Flammschutzmittel in Farben und Lacken
|
|
Vorkommen
|
Wo kommt PCB in Gebäuden vor?
„Offene“ Anwendung:
bis Mitte der 70`er Jahre
v Flammschutzmittel in Farben und Lacke
v Akustikfarbe auf Deckenplatten
v Weichmacher in Bewegungsfugen
v Weichmacher in Fugendichtmassen
v Klebstoff ( z.B. in Glasfasertapeten)
„Geschlossene“ Anwendung:
Herstellung seit 1983 eingestellt
v Kleinkondensatoren in Leuchtstofflampen, Ölbrennern, elektrischen
Schreibmaschinen, Ventilatoren, elektrischen Haushaltsgeräten, wie
Geschirrspüler, Dunstabzugshauben, Waschmaschinen
|
|
Diagnose
|
Feststellung möglicher PCB – Belastung im Gebäude durch:
v Herstellerinformationen, wann und in welchen Fabrikaten PCB-haltige
Transformatoren und Kondensatoren eingesetzt wurden
v Nachforschung über den zeitlichen Einsatz und Art der Inhaltsstoffe
von relevanten Bauprodukten (Fugenmassen, Farben, Lacke,
Akustikdecken)
v Analyse relevanter Bauprodukte auf den gezielten Einsatz von PCB
(Primärquelle)
v Analyse möglicher kontaminierter Bauprodukte und Materialien
v Raumluftmessung
Probenahme von PCB:
v Raumluftmessung:
Ein definiertes Luftvolumen (ca. 2000 l) wird durch ein
Adsorptionsröhrchen (z.B. Florisil, PU-Schaum) gesaugt,
(Volumenstrom max. 2 i/min.)
v Wischprobe:
Abwischen kontaminierter Flächen mit toluolgetränktem Lappen
v Materialprobe:
Entnahme von ca. 10 g verdächtigem Material
|
|
Richtwerte
|
Richtwerte von PCB im Material und in der Raumluft:
Bewertung der Sanierungsdringlichkeit durch Ermittlung der Raumluftkonzentration
< 300 ng PCB / m³ Luft
v langfristig tolerabel (Vorsorgewert)
v möglichst weitere Absenkung der Konzentration durch regelmäßige
Reinigung
300 – 3.000 ng PCB / m³ Luft
v mittelfristige Maßnahmen notwendig (intensive Quellensuche,
regelmässiges und gründliches Reinigen, verstärktes Lüften)
v Reduktion der Konzentration auf 300 ng/m³ innerhalb von ein bis
zwei Jahren
> 3.000 ng PCB / m³ Luft
v Interventionswert
v Einleitung unverzüglicher Maßnahmen
v Kontrollanalysen
v Aufstellen eines Sanierungsplans
v bald möglichste Durchführung der Sanierung
v Absenkung unter 3.000 ng/m³ innerhalb von max. 3 Monaten
– ansonsten Schliessung betroffener Räumlichkeiten
|
|
Maßnahmen
|
Was kann man gegen PCB-Belastungen tun?
Betriebliche Maßnahmen:
v Erhöhte Reinigung
v Lüftung
v Kein Hautkontakt
Bauliche Maßnahmen:
v Entfernen
v Beschichtung
v Räumliche Trennung
Dabei sind zu beachten:
v PCB-Richtlinie
v Persönliche Schutzmaßnahmen
v Arbeitsschutzmaßnahmen
v Erfolgskontrolle durch Raumluftmessungen
v fachgerechte Entsorgung
|
|
Gesundheits-
gefährdung
|
Welche Gesundheitsgefährdung entsteht durch PCB ?
v Aufnahme durch Hautkontakt, Nahrung und Atmung
v Verdacht auf Krebserzeugung
v Ausgasungen der Produkte lagern sich auf Staubträgern, fetthaltigen
Geweben und Lebensmitteln an
v im Brandfall entstehen hochgiftige Verbindungen (Dioxine)
|
|
|
Durch PCB ausgelöste Krankheitsbilder:
|
|
|
v Hautschädigung
v Knochenmarksveränderungen
v Hormonabbau
v Schwächung des Immunsystems
v Stoffwechselstörung der Leber
v Eventuelle Mißbildung Neugeborener
v Mögliche Hemmung körperlicher und geistiger Entwicklung bei
Kindern
|
|
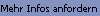
|
Zurück
|
|
|
|
|
Schimmel
|
|
Was ist Schimmel?
|

Schimmel ist ein Sammelbegriff für oberflächlich auf zumeist abgestorbenen organischen Substanzen wachsende Myzelien und Sporenträger. Die organischen Substanzen dienen als Nährstofflieferant, die durch die Nährstoffgewinnung zersetzt werden. Die Vermehrung der Schimmelpilze erfolgt vorwiegend über die Abgabe grösserer Sporenmengen an die Luft, die somit neue zersetzbare Materialien besiedeln können.
Viele Schimmelpilze (z.B. Aspergillus, Penicillium, Fusarium etc.) setzen als sekundäre Stoffwechselprodukte Gifte (Mykotoxine) frei.
Je nach Toxinart können Mykotoxine akut oder chronisch akut sein.
Eine Freisetzung der Mykotoxine in die Raumluft kann durch Verdampfung oder aber über Sporenabgabe erfolgen, was oft unangenehme (moderige) Gerüche verursacht.
|
|
Vorkommen
|
Wo kommt SCHIMMEL in Gebäuden vor?
Befall durch Eintrag
Schimmel kann sich durch die Sporenverbreitung prinzipiell an jeder Stelle ausbreiten, wo sich günstige Nährbedingungen für den Pilz ergeben. Die von vegetativen Fruchtformen abgegebenen Sporenmengen können sich in der Außenluft bei günstigen Witterungsbedingungen über Hunderte von Kilometern verbreiten und einen Eintrag in die Innenraumluft von Gebäuden bedingen und hier auch bisher nicht befallene Bereiche besiedeln, sofern die bauphysikalischen und/oder nutzerspezifischen Vorraussetzungen hierfür gegeben sind.
Bauphysikalische Ursachen
Bauphysikalischen Ursachen für den Schimmelbefall liegen nahezu immer in erhöhter Feuchtigkeit.
Verantwortlich dafür sind in erster Linie Bauschäden, die einer Kondensatbildung Vorschub leisten.
Mängel an der für einen Kondensatschutz wichtigen Wärmedämmung und Dampfsperre zeigen sich wiederholt an Detailpunkten:
v Außenecken
v Anschlüsse von Fenstern, Türen, Auskragungen etc.
v Pfeilern
v Heizkörpernischen
v Rollladenkästen
v einbindende Betondecken
v vorgestelltes Mobiliar / feuchteabsperrende Innenverkleidungen etc.
Darüber hinaus können direkte bauliche Mängel eine Schimmelpilzbildung begünstigen:
v mangelhafte oder beschädigte wasserführende Bauteile
v mangelhafte Sperrschichten
v unzureichende Bauaustrocknung etc.
|
|
Diagnose
|
Feststellung möglicher SCHIMMEL – Belastung im Gebäude durch:
v Besichtigung der wahrscheinlichen Befallstellen
Überprüfung auf einen offenen, deutlich erkennbaren mikrobiellen
Befall mit organoleptischer Ansprache
Als weiterführende Erhebung auch zur Überprüfung aller kritischen
Bereiche einschl. verdeckter Bauteile und Hohlräume (insbes. bei
älterem Befall, der sich z.B. durch starken Milbenfraß auszeichnet)
v Material- und Kontaktproben
Eventuelle Abklatschprobe parallel zu Raumluftmessungen.
(vergleichende Analytik des Pilzes mit der Sporengattung / -spezies)
Kann bei einem offenem Befall auch zur ersten Gefährdungsschätzung
herangezogen werden
v Raumluftmessungen
Quantitative wie qualitative Bestimmung lebender Pilzsporen in der
Innenraumluft im Vergleich zur ubiquitären Grundbelastung der
Außenluft (mit Referenzmessung der Außenluft).
Die Konzentration wird in koloniebildenden Einheiten (KBE) / m³
angegeben.
Die qualitative Bestimmung der Pilzart erfolgt auf Gattungs- oder
Speziesebene.
Die quantitative wie qualitative Betrachtung erlaubt erste Rückschlüsse
auf die Ursache des Befalls, ist jedoch stark von Zeitpunkt der
Probenahme abhängig (nicht kontinuierlicher Sporenflug,
Witterungsverhältnisse etc.)
v MVOC-Bestimmung
Hochsensitve, chemische Ermittlung der sekundären Pilz-
Stoffwechselprodukte (mikrobiologisch produzierte flüchtige
organische Verbindungen) in der Raumluft. Auch geeignet zur
orientierenden Erhebung eines verdeckten Befalls (z.B. in Hohlräumen
der Bausubstanz)
|
|
Richtwerte
|
Richtwerte von SCHIMMEL in der Raumluft:
Dosis-Wirkungsbeziehungen zwischen der Konzentration von Pilzsporen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind wissenschaftlich nicht begründet, gesetzlich gültige Grenzwerte insofern nicht festgelegt. Zur Bewertung können folgende Schwellenwerte mit orientierendem Charakter parallel herangezogen werden:
Bewertung nach Innenraumluftkonzentration
Entsprechend fachlicher Publikationen liegt die Konzentration koloniebildender Einheiten in der Raumluft unbelasteter Gebäude
zwischen 150 und 500 KBE / m³.
Von einer hygienischen Klärung wird ausgegangen, wenn:
Die Innenraumluftkonzentration an Schimmelpilzen bei > 500 KBE/m³ liegt
Bewertung nach Referenzwert der Außenluft
Die Bewertung einer gefundenen Konzentration im Innenraum unterliegt immer eines vor Ort, zeitnah erhobenen Referenzwertes der Außenluft. Da Schimmelpilze und andere Mikroorganismen ubiquitär in der natürlichen Luft vorkommen, ist ein Eintrag der Sporen in Nutzungsbereiche ebenso in Betracht zu ziehen.
Von einer hygienischen Klärung wird ausgegangen, wenn:
Die Innenraumluftkonzentration an Schimmelpilzen um > 100 KBE/m³ über dem parallel gemessenen Referenzwerte der Außenluft liegt.
Darüber hinaus muss auch die Zusammensetzung der Pilzflora nach Gattung / Spezies (qualitative Bestimmung), der Nutzerkreis (nach seinen gesundheitlichen Konstitutionen), Art, Dauer und Zeitpunkt der Probenahme in der Bewertung berücksichtigt werden.
|
|
Maßnahmen
|
Was kann man gegen SCHIMMEL-Belastungen tun?
Bauliche Maßnahmen:
v Übergangsweises diffusionsdichtes Abdecken/Abschotten
v Vollständiges Entfernen des befallenen Materials
(Einrichtungsgegenstände berücksichtigen)
v Eventuell biologische Methodik zur Austrocknung des Pilzes
v Behebung der Ursachen zur Abwendung von Neubildungen
Nutzungsbedingte (vorläufige bzw. präventive) Maßnahmen:
v Verstärkte Lüftung
v Freistellung der Wände (Möbel, Bilder, etc.)
Dabei ist zu beachten:
v Arbeitsschutzmaßnahmen (Biostoffverordnung, Technische Regeln für
biologische Arbeitsstoffe/TRBA)
v Persönliche Schutzmaßnahmen
v Fachgerechte Ausführung und Entsorgung
v Kontrollmessung
Generell sind die zu wählenden Maßnahmen abhängig von vielen Faktoren wie Art, Zusammensetzung, Umfang, Ursache etc. des Pilzbefalls.
|
|
Gesundheits-
gefährdung
|
Welche Gesundheitsgefährdung entsteht durch SCHIMMEL?
Gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Personen, die sich dauerhaft in Räumen mit Schimmelpilz-belasteter Luft aufhalten und auf Schimmelpilze zurückzuführen sein können sind z.B:
v Allergien
v Sick Building Syndrom
v Mykotoxikosen
v Mykosen (bisher nur bei immungeschwächten Personen beobachtet)
v Atemnot
v Konzentrationsmangel
v Asthma
v Lungenfibrose
Noch nicht abschliessend geklärt ist, ob durch mikrobiologisch produzierte organische Verbindungen (MVOC) Krankheitsbilder verursacht werden. Es wird vermutet, dass Schleimhautreizungen oder Kopfschmerzen auf MVOC zurückzuführen sein können.
Alle Schimmelpilzspezies besitzen allergenes Potential, die für immunschwache Wirtspersonen auch unterhalb bekannter Schwellenwerte Beeinträchtigungen hervorrufen können.
Eine Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen der Konzentration koloniebildender Einheiten in der Raumluft und gesundheitlichen Reaktionen ist jedoch medizinisch nicht nachgewiesen.
|
|
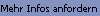
|
Zurück
|
|
|
|
|
KMF
|
|
Was ist KMF?
|
Künstliche Mineralfasern (KMF) sind ein Produkt aus mineralischen Rohstoffen (Silikatschmelze)
Fasertypen:
v Steinwollefasern
v Glaswollefasern
v Keramikfasern
v Spezialfasern
Eigenschaften:
v nicht brennbar
v sehr gute Wärmedämmwirkung
v schallabsorbierende Wirkung
v beständig gegen Hitze
v relativ beständig gegen Wasser und Chemikalien
v feinnadelige Aggregate
v Unterteilung in
- textile (spinnbare) Fasern
- nicht textile Fasern ( Schlacke-, Stein-, Glasswolle-)
|
|
Vorkommen
|
Wo kommt KMF in Gebäuden vor?
Verwendung:
v im Wärme- und Schallschutz
v in Innenwänden/Leichtbauwänden,
v in Akustikdecken,
v in Fußböden,
v im Dachausbau,
v für Außenfassaden,
v als Trittschalldämmung unter dem Estrich,
v in Mineralfaser-haltigem Putz,
v als Wärmedämmung in Rolladenkästen.
v im Brandschutz, z.B. beim Fassadenbau oder für Spritzisolierungen.
|
|
Diagnose
|
Feststellung möglicher KMF – Belastung im Gebäude durch:
Nachforschung über den zeitlichen Einsatz
v Bei KMF-Produkten die bis ca. 1979 hergestellt wurden (Einbaujahr
kann ggf. abweichen) kann in der Regel von einem KI < 30
ausgegangen werden. Hier ist eine Analytik nicht unbedingt
erforderlich, sie kann zur Verifizierung jedoch dienlich sein.
v Bei KMF-Produkten ab Herstelljahr ca 1979 empfehlen wir eine
Analytik zur Bestimmung des KI-Wertes.
Probenahme von KMF:
v Raumluftmessung:
Ein definiertes Luftvolumen wird durch ein mit Gold beschichteten
Kernporenfilter gesaugt.
(Volumenstrom max. 2 m³/h)
v Kontaktprobe
Abtupfen kontaminierter Flächen mit Klebestreifen
v Materialprobe
Entnahme relevanter Materialien
|
|
Grenz- und Richt-
werte von KMF
|
Einstufung in eine Sanierungsdringlichkeit
Für KMF sind keine Richtlinien erlassen, in deren Geltungsbereich eine Bewertung von KMF-Produkten fallen würde.
Eine Einstufung von KMF-Produkten in eine Sanierungsdringlichkeitsstufe ist nicht zulässig.
Orientierend heranziehbar:
Unter Voraussetzung der Vergleichbarkeit der Wirkmechanismen von KMF zu denen von Asbest:
Hintergrundwert für Innenräume < 1.000 Fasern/m³
Aber: keine Handlungsdringlichkeit ableitbar
Einstufung von KMF nach Kanzerogenitätsindex (KI)
v Reine Beurteilung der kanzerogenen Potenz
v Keine gesetzlich verankerte Ableitung einer Handlungsdringlichkeit
|
KI-Wert
|
Einstufung
|
|
KI-Wert < 30
|
wahrscheinlich kanzerogen
|
|
KI-Wert 30-40
|
möglicherweise kanzerogen
|
|
KI-Wert > 40
|
nicht kanzerogen
|
(KI)= Kanzerogenitätsindex
Richtwerte bei Arbeiten mit KMF
Technische Richtkonzentration
Auf Baustellen gilt die technische Richtkonzentration von 250.000 Fasern/ m³ als eingehalten, wenn die Gesamtfaserzahl lichtmikroskopisch nachgewiesen unter 500.000 Fasern/m³ liegt.
Stationäre Altanlagen
bis 31.12.1995 1.000.000 Fasern/m³
TRK-Wert am Arbeitsplatz 500.000 Fasern/m³
Welche Massnahmen können bei KMF–Vorkommen ergriffen werden?
|
|
Maßnahmen
|
Aus Vorsorgegründen können folgende Massnahmen ergriffen werden:
Betriebliche Massnahmen:
v Vermeidung von Einwirkungen auf das Material
v Regelmäßige Naßreinigung
v Änderung der Raumnutzung bzw. Außerbetriebnahme
Bauliche Massnahmen:
v Entfernen
v Beschichten
v Räumliche Trennung
Dabei sind zu beachten:
v Arbeitsschutzmaßnahmen
v Persönliche Schutzmaßnahmen
v Fachgerechte Ausführung und Entsorgung
v ggf. Kontrollmessung
v TRGS 521 Faserstäube
|
|
Gesundheits-
gefährdung
|
Welche Grundlagen sind zur Beurteilung gesundheitlicher Risiken vorhanden?
Kritische Faserabmessungen (lungengängig)
v Länge > 5 µm
v Durchmesser < 3 µm
v Länge/ Durchmesser > 3:1
v Längsspaltung (analog Asbestfasern) bis dato nicht nachgewiesen
v Vorhandensein lungengängiger Fasern mit Ø<1µm nachgewiesen
Hypothese
auf Grundlage der Tierversuche (über Feinstaubinjektion):
v biologische Relevanz im Ø –Bereich <3µm
v Wirkungsmaximum unter 0,5µm Ø
Einstufung nach GefStoff V
v Nach MAK-Kommission im Tierversuch als eindeutig krebserzeugend
erwiesen in Folge Einstufung von Glas- und Steinwolle in „als ob III A2“
Welche gesundheitsgefährdenden Potentiale bestehen?
Beurteilung nach Tierversuchen
v Versuchsauswertung und Risikoabschätzung in Anlehnung an
epidemiologische Daten von Asbest
Risikoabschätzung durch KMF setzt voraus, das:
v der biologische Wirkmechanismus der faserinduzierten
Tumorhäufigkeit bei Mensch und Tier gleichzusetzen ist
v die Wirkmechanismen für KMF im wesentlichen mit denen für
Asbest gleichzusetzen sind.
Mögliche Krankheitssymptome ausgehend von der Risikoabschätzung
v Reizung der Schleimhäute
v Reizung der Atemwege
v Schädigung der Atmungsorgane
Lungenentzündung / Asthma / Bronchitis
(nach langfristiger Inhalationszeit)
v kanzerogene Potenz
|
|
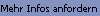
|
Zurück
|
|
|
|
|
PCP
|
|
Was ist PCP ?
|
Pentachlorphenol (Abkürzung: PCP) gehört zur Gruppe der Organochlorpestizide und ist ein starkes Gift für Mikroorganismen (Fungizid), Pflanzen (Herbizid), Insekten (Insektizid) und Fische. PCP ist ein geruchloser, weißer, nadelförmiger Feststoff. In Wasser ist es nur schwer löslich; gut dagegen in Alkohol und anderen organischen Lösungsmitteln.
|
|
Verwendung
|
PCP wird bzw. wurde als Holzschutzmittel, Leder- und Textilkonservierungsmittel sowie als Desinfektionsmittel eingesetzt. In Deutschland ist der Einsatz von PCP praktisch verboten. Bei Importprodukten kann die Verwendung von PCP jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Als mögliche PCP-Quellen in Gebäuden kommen vor allem in Betracht:
v Holzoberflächen von Wandverkleidungen, Balken, Türen,
Vertäfelungen, Böden, Fenster, Möbel;
v Dachstühle, Fachwerk und andere Holzkonstruktionen;
v Textilien wie Lederbekleidung, Ledermöbel, Markisen, Zelte;
v Klebstoffe;
v Farben und Lacke;
v Mineralöle.
|
|
Gesundheits-
gefährdung
|
Beschwerden können auch erst nach Stunden oder Tagen auftreten.
v Entfettet die Haut
v Erbrechen mit Bauchschmerzen
v Gefahr der Hautresorption
v Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken
v Irreversibler Schaden möglich
v Kann Verätzungen verursachen, d.h. kann Atemwege, Augen, Haut
und Verdauungswege bis zur Zerstörung schädigen
v Lungenödem
v Nervenschäden sind möglich, z.B. Krämpfe, Zittern, Lähmungen
v Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
v Schädigung des Blutes
v Schädigung des Herzes
v Schädigung des Knochenmarks möglich
v Schädigung von Leber und Nieren möglich
v Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit bis zur Bewusstlosigkeit
oder andere Hirnfunktionsstörungen können auftreten
v Sehr giftig beim Einatmen
v Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig
schädliche Wirkungen haben
v Stoffe, die als fruchtschädigend für den Menschen angesehen werden
sollten
v Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen werden
sollten
v Stoffe, die wegen möglicher erbgutverändernder Wirkung beim
Menschen Anlaß zur Besorgnis geben
|
|
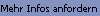
|
Zurück
|
|
|
|
|
VOC
|
|
Was ist VOC?
|
VOC ist die Abkürzung für volatile organic compounds (= flüchtige organische Substanzen). Gemäß Definition der Weltgesundheitsorganisation sind VOC Organische Substanzen mit einem Siedebereich von 60 bis 250°C. Zu den VOC zählen z.B. Verbindungen der Stoffgruppen Alkane/Alkene, Aromaten, Terpene, Halogenkohlenwasserstoffe, Ester, Aldehyde und Ketone.
|
|
Vorkommen/ Quellen
|
Es gibt eine Vielzahl von natürlich vorkommenden VOC, die zum Teil auch in erheblichen Mengen in die Athmosphäre abgegeben werden, z.B. Terpene und Isopren aus Wäldern.
Die durch menschliche Aktivitäten verursachte Umweltbelastung durch VOC ist im letzten Jahrhundert stark angestiegen. Den größten Anteil daran hat der Verkehr, aber schon an zweiter Stelle steht der Bausektor mit den bauchemischen Produkten wie z. B. Anstrichstoffe, Klebstoffe oder Dichtungsmassen. Mögliche Quellen von VOC in Innenräumen sind neben den Baustoffen auch Einrichtungsgegenstände, Reinigungs- und Pflegemittel, Hobby- und Heimwerkerprodukte, Bürochemikalien und vor allem Tabakrauch. Ein wesentlicher Träger von VOC sind Teppichböden. Geruchsprobleme durch VOC können auch mikrobiell, durch Stoffwechselsubstanzen von Bakterien und Pilzen, verursacht werden.
|
|
Gesundheits-
gefährdung
|
Die VOC haben eine wichtige Bedeutung für die Luftqualität, vor allem in Innenräumen. Das Gefährdungspotential durch diese Stoffgruppe lässt pauschal jedoch kaum angeben, da es sich um eine Vielzahl ganz verschiedener Stoffe handelt, die dementsprechend auch ganz unterschiedliche Wirkungen auf die Gesundheit haben. Mit folgenden Aussagen kann die VOC-Problematik aber umrissen werden:
v VOC spielen bei der Bildung von bodennahem Ozon eine wichtige
Rolle. Deshalb sind die vom Menschen verursachten
Emissionsmengen so klein wie möglich zu halten.
v Zu den VOC gehören einige Verbindungen, die als hochgiftig
beziehungsweise sogar als krebserregend eingestuft sind – wie z.B.
das als Benzinzusatz verwendete Benzol. Auch hier ist es wichtig,
solche Stoffe möglichst schnell durch andere zu ersetzen, die diese
Gefährdung nicht mit sich bringen.
v Für typische Symptome des Sick-building-Syndroms wie trockene
Schleimhäute der Augen, der Nase und des Rachens werden VOC
verantwortlich gemacht. Außerdem wurden Nasenlaufen,
Augentränen, Juckreiz, Müdigkeit, Kopfschmerzen, eingeschränkte
geistige Leistungsfähigkeit, erhöhte Infektionsanfälligkeit sowie
unangenehme Gerüche und Geschmackswahrnehmungen beobachtet.
|
|
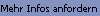
|
Zurück
|
|
|
|
|
|
|
|